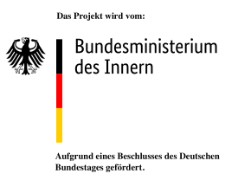Seltsam vertraut, gleichwohl ganz anders
Ladinisch und Nordfriesisch sind in einer ähnlichen Situation – doch es wird verschieden damit umgegangen
Ende Mai tagte die Arbeitsgemeinschaft „Non-Kin-State“ der FUEN im Südtiroler Gadertal. Christoph G. Schmidt, der Direktor des Nordfriisk Instituut, das sich der Erforschung, Förderung und Pflege der nordfriesischen Sprache, Geschichte und Kultur widmet, war als Gastredner dabei und traf auf so manche Verbindung zum Friesischen.
Eine angestammte Sprache, die nur von einer kleinen Gruppe gesprochen wird und sich auch noch in stark unterschiedliche Dialekte gliedert. Umgeben von einer deutlich stärkeren Regional- und einer dominierenden Nationalsprache. Dazu ein Weltnaturerbe, von dessen Einrichtung sich Einheimische in ihren Gewohnheiten bedroht sahen, das heute aber als Hauptverdienstquelle unverzichtbar scheint. Damit wiederum einhergehend die Gefahr von „Übertourismus“ mit all seinen Folgen wie kaum bezahlbaren Immobilienpreisen, nur wenigen Arbeitsplätzen für Hochqualifizierte und Freiberufler, starkem Zuzug von Menschen, welche die traditionellen Sprachen nicht beherrschen, während jüngere Menschen aus den angestammten Familien die Region verlassen. Die nordfriesischen Inseln? So könnte man meinen. Aber die Region, von der hier die Rede ist, sieht doch ein wenig anders aus, vor allem liegt sie rund anderthalbtausend Meter höher und deutlich weiter südlich: Die ladinischen Täler in Südtirol, im Trentino und in Venetien.
Diese strukturellen Gemeinsamkeiten laden geradewegs dazu ein, die Situation der nordfriesischen mit derjenigen der ladinischen Sprache zu vergleichen. Was in Nordfriesland die Inseln und Marschlande im bzw. am Weltnaturerbe Wattenmeer sind, sind in „Ladinien“ die Täler des Weltnaturerbes Dolomiten; je kleinteiliger der Naturraum, desto unterschiedlicher die Dialekte. In beiden Regionen genügt es heute zudem, die Hochsprachen Italienisch (Südtirol) bzw. Deutsch (Nordfriesland) zu beherrschen; niemand muss Friesisch oder Ladinisch lernen, um sich vor Ort verständigen zu können. In beiden Regionen gibt es neben der Staats- und der Minderheitssprache mit Deutsch (Südtirol) und Plattdeutsch (Nordfriesland) eine weitere, weit verbreitete regionale Sprache, die zwangsläufig im Ringen um Ressourcen und Aufmerksamkeit eine gewisse Konkurrenzrolle zu Friesisch bzw. Ladinisch einnimmt. Und auch wenn in Nordfriesland keine olympischen Spiele anstehen, so ist das Thema Gentrifizierung und Profitmaximierung „externer“ Investoren hier ebenfalls ein großes. Wie mit dieser durchaus ähnlichen Situation umgegangen wird, ist jedoch bemerkenswert verschieden.
Was in St. Vigil / Al Plan als erstes auffällt, ist – neben den unzähligen Hotels – die konsequente Dreisprachigkeit sämtlicher Verkehrsschilder, von Wegweisern über Gefahrenzeichen bis hin zu Fahrradwegen. In durchweg gleicher Schriftgröße und mit Ladinisch an erster Stelle. Es geht also, so möchte man Nordfriesland ins Stammbuch schreiben. Allerdings wurde uns berichtet, dass jenseits der amtlichen Beschilderung immer häufiger auch englischsprachige Hinweise erwünscht sind, und dann entfalle das Ladinische erfahrungsgemäß als erstes.
Eines aber bildet die Grundlage für alles Weitere, nämlich eine exakte Statistik und darauf beruhend detaillierte rechtliche Regelungen. Das ladinische Sprachgebiet ist in Südtirol genau definiert, und nur dort greifen entsprechende Privilegien. Alle zehn Jahre erfolgt eine Volkszählung, bei der auch erfasst wird, welche Personen ab 14 Jahren sich welcher Sprachgruppe zuordnen. Mehrfachidentifizierung ist unzulässig, denn gemäß dieser Angaben werden die öffentlichen Geldmittel verteilt und die staatlichen Stellen ausgeschrieben. Und anhand dieser Daten wird festgelegt, was als ladinisches Sprachgebiet gilt, nämlich diejenigen Gemeinden, in denen die größte Gruppe der Einwohnerschaft die ladinische Sprache ankreuzt. Übertrüge man dieses Schema auf Nordfriesland, dann wäre Friesisch außerhalb von Föhr-Land wohl unsichtbar.
Im Gegenzug kann sich jeder EU-Bürger, der in Südtirol lebt, individuell für eine der drei Sprachgruppen (Italienisch, Deutsch, Ladinisch) entscheiden, um sich auf entsprechende Stellen im öffentlichen Dienst bewerben zu dürfen. Das Bewerbungsverfahren wird dann in der jeweiligen Sprache durchgeführt. Diese persönliche Zuordnung wechseln darf man alle fünf Jahre, mit zwei Jahren Vorlauf. Ein solches System wäre in Deutschland undenkbar, nicht zuletzt, weil derartige Erfassungen im „Dritten Reich“ als Grundlage für Völkermorde dienten. Natürlich wird solch ein Schubladendenken der vielschichtigen Realität mit ihren Grauzonen und Überlagerungen nicht gerecht, aber es sichert die Präsenz der „kleineren“ Sprachen zumindest in der öffentlichen Verwaltung, an Schulen, in Sozialdiensten oder Krankenhäusern. „Ladinische“ Stellen sind dabei allerdings nur für das Sprachgebiet, für die Dolomitentäler vorgesehen, nicht aber z. B. in der Provinzhauptstadt Bozen. Das führt dazu, dass Hochqualifizierte oft keine passenden Proporzstellen finden; andererseits können manche Arbeitsplätze, für welche Dreisprachigkeit vorgesehen ist, oftmals gar nicht qualifiziert besetzt werden. Derzeit sind von 175 Stellen, die in den Gesundheitsdiensten für ladinischsprachige Bewerberinnen und Bewerber reserviert sind, nur rund die Hälfte vorschriftsgemäß vergeben.
In einer Grundschule, die wir besuchen, stehen alle Klassentüren offen, wir dürfen überall zuhören. Kinder sollen das Schreiben in allen drei Sprachen erlernen; idealerweise ändert sich daher wöchentlich die Unterrichtssprache für alle Fächer. In Sing- und Sprachspielen hörten wir schon im Kindergarten alle drei. Durch einen Flur verbunden, betreten wir die weiterführende Mittelschule; hier wird etwa hälftig auf Italienisch und Deutsch unterrichtet, jedes Fach ist der einen oder der anderen Sprache zugeordnet. Ladinisch findet ab der fünften Klasse nur noch mit zwei Wochenstunden und im (katholischen) Religionsunterricht Raum. Es gilt jedoch als lingua franca, die immer dann benutzt werden darf, wenn jemand etwas auf Deutsch oder Italienisch nicht so ganz versteht oder ausdrücken kann. Eindrucksvoll, wie souverän auch nichtmuttersprachliche Kinder zwischen den drei Sprachen wechseln.
Zum Vergleich: Nordfriesisch wird in Nordfriesland fast nur an Grundschulen unterrichtet, meist freiwillig, mit wenigen Wochenstunden, oft für Kleingruppen oder nur eine einzige Klassenstufe. Es ist – leider – eine völlig andere Welt. Und wenn man bedenkt, dass mit Ladinisch überwiegend muttersprachlichen Kindern Lesen und Schreiben beigebracht werden, Friesischunterricht jedoch vor allem Spracherwerb überhaupt erst ermöglichen soll, wirkt der Unterschied noch grotesker.
Dreisprachigkeit ist also für Lehrkräfte Voraussetzung, um an Schulen im ladinischen Sprachgebiet unterrichten zu dürfen. Ich frage Ludwig Rindler, Direktor der ladinischen Schulen im Tal, ob dies auch im Studium entsprechend unterrichtet werde. Die Antwort ist ernüchternd: Sprachkenntnisse, vor allem das Ladinische würden die jungen Menschen ja von Zuhause mitbringen. Ladinisch ist eben vor allem deswegen präsent, weil es von der Bevölkerung, von den Familien getragen wird. Die Zahlen freilich sinken, zwar langsam, aber konstant: So im Fassatal zwischen 1991 und 2021 in der Gemeinde Mazzin von 86 % auf 52 % und in der Gemeinde Moena von 75 % auf rund 50 % – wie lange das System noch tragen wird, ist also fraglich.
Die Autonomiestatute, rechtliche Grundlage für den mehrsprachigen Schulunterricht und die regionalen Verwaltungssprachen, entstanden bald nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie gelten allerdings nur für die Region Trentino-Südtirol, nicht für Venetien, wo das Ladinische einen deutlich schwierigeren Stand hat. Noch wenige Jahre zuvor, 1939, waren alle Südtiroler aufgefordert, sich zwischen Italienisch und Deutsch zu entscheiden, entweder ins Deutsche Reich (Österreich gehörte seit 1938 dazu) zu ziehen oder sich zu assimilieren. Das war eine Vereinbarung zwischen den Diktatoren Hitler und Mussolini, um ethnisch homogene Nationalstaaten zu erreichen. Beides hätte wohl das Ende der ladinischen Sprache und Kultur bedeutet. Eine weitere Parallele zu den Nordfriesen: 1920 standen für sie mit Deutsch und Dänisch auch nur zwei Nationalidentitäten zur Wahl, nicht aber friesisch. Kriegsbedingt wurde die sogenannte „Option“ (die Auswanderung ins Deutsche Reich) in Südtirol nur noch ansatzweise umgesetzt, die tiefen gesellschaftlichen Risse aber wirkten lange nach.
Nordfriesischsprachige Medien gibt es praktisch nicht, und wenn, dann werden sie oft ehren- oder nebenamtlich erstellt; von friesischsprachigem Journalismus leben kann niemand, die Texte für die (inzwischen eingestellte) friesisch-plattdeutsche Seite in der shz wurden nicht einmal vergütet. Auf Ladinisch dagegen gibt es „La Usc di Ladins“; gegründet wurde diese Zeitung 1949 als „Nos Ladins“, anfangs privat finanziert und von zahlreichen Freiwilligen gefüllt. Ab 1972 professionalisiert und umbenannt, erscheint sie heute jeden Sonnabend, durchweg auf Ladinisch. Nach wie vor arbeiten viele ehrenamtlich mit, den Kern des Teams aber bilden fünfzehn Hauptamtliche in fünf lokalen Redaktionen: Ausgebildete Journalisten, Redakteure und Grafiker. Chefredakteur Iaco Rigo ist auch als Aktivist und Musiker weithin bekannt. Regionale Themen, Politik, Kirche und Tourismus stehen im Vordergrund. Wobei freimütig eingeräumt wird, dass eine besondere Sensibilität gefordert sei: Oft kenne man sich persönlich und begegne sich natürlich auch in anderen Zusammenhängen, was kritischen Journalismus nicht unbedingt vereinfachte, so sagt uns Pablo Palfrader, Leiter der Lokalredaktion Gadertal. Bemerkenswert ist eine Randbemerkung: Noch vor 20 Jahren seien viele Beiträge auf Deutsch oder Italienisch eingereicht und übersetzt worden; inzwischen aber würde mehr und mehr direkt auf Ladinisch geschrieben. Bedient werden zwar insgesamt sieben Dialekte; die Norm aber sei das 1988 vom Schweizer Sprachwissenschaftler Heinrich Schmid entwickelte Standardladinisch „Ladin Dolomitan“, es habe „die Sprache gerettet“. Ohne dieses gebe es weder erfolgreichen Journalismus noch die öffentliche Beschilderung. Nicht alle in den Dolomitentälern sehen das „Ladin Dolomitan“ so positiv, aber es ist nicht von der Hand zu weisen: Wenn wir als Nordfriisk Instituut etwas auf Frasch veröffentlichen, wird es auf Föhr nicht gelesen. Und umgekehrt. Also nutzen wir Hochdeutsch für alles, was alle erreichen soll. Ein verbindender Schriftstandard kann in dieser Hinsicht durchaus hilfreich sein – wenn er denn akzeptiert wird.
Auch „La Usc di Ladins“ leidet jedoch unter Faktoren, die sich kaum ändern lassen: Zunehmend werden Online-Inhalte eingefordert, Videos und möglichst kurze Texte, doch bezahlen möchte kaum jemand dafür. Die Druckauflage sinkt, wie lange die Finanzierung – je ein Drittel Abonnements, Inserate und öffentliche Förderung – diesen professionellen Journalismus in einer kleinen Sprache noch sichern kann, ist daher offen.
Was mir besonders auffällt, ist das Selbstbewusstsein, mit dem Ladinisch überall präsent ist. Niemand geniert sich für die eigene Sprache, die Wertschätzung durch die Sprecherinnen und Sprecher wirkt groß. Freilich stellen sie im „Sprachgebiet“ durchweg die Mehrheit, was für Nordfriesisch in Nordfriesland beileibe nicht gilt. Wesentlich aber scheint mir auch das traditionelle Umfeld, die „Kultur“ zu sein, wie ich sie am Rande mitbekomme. Es gibt zahlreiche Chöre und Gesangsensembles. Religion spielt eine große, verbindende Rolle. Prozessionen, die in der Morgenfrühe beginnen, über viele Kilometer von einer Kirche zur nächsten, gehören einfach dazu; manche reisen extra dafür an. Wir besichtigen eine kleine Kirche, die steil am Hang gelegen an einen stattlichen Hof und eine kleine Häusergruppe, eine „vila“, angrenzt. Die frisch renovierten Wandmalereien leuchten. Messe wird hier nur zweimal im Jahr gefeiert. Selbstverständlich aber kommt jeden Abend jemand hierher, um die Glocke zu läuten; die benachbarten Höfe teilen diese Ehre unter sich auf.
Beim Abschiedsfest in einer traditionellen Trattoria erhalte ich ein prachtvolles Buch geschenkt: Gut 170 Seiten mit Legenden aus den Dolomitentälern, auf Standardladinisch geschrieben, aber via QR-Code in sieben verschiedenen Dialekten zu hören; vor allem jedoch höchst gekonnt illustriert, von Schülerinnen und Schülern zweier Gymnasien mit Kunstoberstufen – Ladinisch an Schulen gilt beileibe nicht als Kinderkram. Etwas neidisch darf man da wohl werden. Eine junge Geschichtslehrerin, Sofia Stuflesser, die mit mir am Tisch sitzt, hatte dieses Projekt geleitet. Sie ist zugleich Präsidentin des Ladinischen Vereins im benachbarten Grödnertal. Im Aufbruch empfiehlt sie mir die 2010 gegründete Frauenband „Ganes“, benannt nach mythischen Wasserwesen und inzwischen überregional bekannte Botschafterin ladinischer Kultur. Interessiert schlage ich auf der Rückreise zu dieser experimentierfreudigen Folkpopgruppe nach. Als eine der drei Sängerinnen vor einigen Jahren ausstieg, suchten die beiden verbliebenen adäquaten Ersatz: Gefunden wurde, ja genau, eine (Ost-)Friesin.
Christoph G. Schmidt
Quelle des Artikels: Zeitschrift Nordfriesland Nr. 231, Herbst 2025 (herausgegeben vom Nordfriisk Instituut)